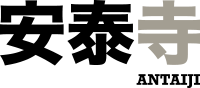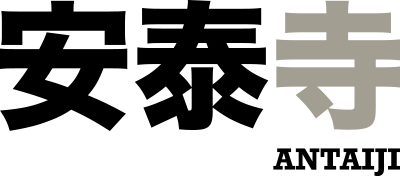Photo von Eva Rugel (Antaiji, August 2017): evarugelphotography.de
Photo von Esther Bosch (Schin op Geul, September 2016): dogen-zen.nl
Mehr von Muhos PR-Tour im Herbst 2016 & 2018: antaiji.org/de/history/about/video/
Die Zeit wartet auf niemanden
Mit zunehmendem Alter scheinen die Jahre immer schneller zu vergehen. Als hätte jemand die Vorspultaste des Lebens gedrückt und vergessen, sie wieder loszulassen. Seltsam nur, dass mein Atem nicht schneller geht als vor zehn, zwanzig oder dreißig Jahren. Wenn ich nicht zurückschaue, sondern mich nur auf den gegenwärtigen Moment konzentriere, scheint sich überhaupt nichts verändert zu haben. Bin ich ein anderer als der, der ich früher einmal war?
Jedes Jahr dieselben Blüten
Jedes Jahr andere Menschen
So lautet ein alter chinesischer Spruch, der viele Asiaten an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert. Der chinesische Jahresanfang fällt meist in den Februar, wenn die Aprikosenbäume zu blühen beginnen. Der Reihe nach erfreuen dann die Pfirsich-, Pflaumen- und schließlich die Kirschbäume die Menschen mit ihren Blüten. Nehmen die Jahreszeiten ihren gewohnten Lauf, kann man leicht vergessen, dass man selbst dem Tod mit jedem Tag, der vergeht, ein Stückchen näher kommt. Vielleicht erscheinen uns auch deshalb die Jahre mehr und mehr wie im Flug zu vergehen, weil sie uns immer kostbarer werden.
Aber der Spruch sagt eben nur die halbe Wahrheit. Es sind nicht jedes Jahr „dieselben Blüten“. Sie sind ebenso einmalig wie wir Menschen. Nur dem, der nicht genau genug achtgibt, erscheinen sie austauschbar. Die Kirschblüten im Frühling und das Ahornlaub im Herbst meines fünfzigsten Lebensjahrs wird es nur dieses eine Mal geben und dann niemals wieder.
Auch in diesem April haben sich meine Familie und die ganze Klostergemeinschaft wieder um ein großes Lagerfeuer unter den blühenden Fruchtbäumen versammelt, um das Ende des Winters und den Beginn des Frühjahrs zu feiern. Erst wenn ich mir Bilder von unseren früheren Festen ansehe, wird mir bewusst, wie flüchtig alles ist. Die wenigsten Klosterbewohner bleiben länger als drei Jahre. Viele von ihnen brechen plötzlich auf, einige sogar bei Nacht und Nebel. Manchmal frage ich mich, was aus all denen geworden ist, die Antaiji enttäuscht verlassen haben. Konnten sie trotz allem etwas für ihr weiteres Leben mitnehmen? Haben sie etwas gelernt, oder ist da nur Bitterkeit, wenn sie sich erinnern?
Von den Bewohnern, die schon im Kloster lebten, als mein jüngster Sohn Taku zur Welt kam, ist heute nur noch Michiko da, eine ehemalige Hebamme. Sie hat miterlebt, wie prächtig er sich entwickelt hat. Mittlerweile geht er schon zur Schule.
Jeden Morgen um Viertel nach sieben, wenn der Rest der Gemeinschaft mit einer Tasse Tee in der Morgensonne sitzt, bringe ich meine Kinder mit dem Auto zur fünf Kilometer entfernt gelegenen Bushaltestelle. Eigentlich könnten sie auch mit dem Fahrrad fahren, aber Tomomi fürchtet die Kragenbären, die in den Bergen rings um das Kloster leben. Mit einem „Es wird schon alles gutgehen“ meinerseits gibt sie sich inzwischen längst nicht mehr zufrieden.
Zurück kommen die Kinder erst nach Einbruch der Dunkelheit, wenn im Kloster alle bei der Abendmeditation sind. Dann müssen noch Schulaufgaben gemacht werden. Wenn die Kinder schließlich auf ihre Zimmer gehen, ist in Antaiji lange schon vollkommene Ruhe eingekehrt. Die Mittelschule gleicht in Japan einem Vollzeitjob. Manchmal fragen mich Hanna und Kay, meine beiden älteren Kinder: „Was machen deine Gäste eigentlich den ganzen Tag lang?“
Dann erkläre ich ihnen, dass die Klosterbewohner nicht meine Gäste sind, sondern Menschen, von denen einige eine Karriere aufgegeben und ganze Ozeane überquert haben, um in den Bergen das zu finden, was ihnen im Leben bisher gefehlt hat. Was das denn sei, wollen meine Kinder wissen.
„Jeder hat seinen eigenen Ausdruck dafür. Die einen suchen nach ihrem wahren Selbst, andere nach dem Sinn des Lebens. Die meisten von ihnen haben festgestellt, dass sich die moderne Welt in eine Sackgasse manövriert hat. Sie glauben, dass das Klosterleben eine Alternative zum Alltag im Kapitalismus sein könnte.“ Spätestens wenn ich an diesem Punkt meines Vortrags angelangt bin, verdrehen meine Kinder die Augen. Vielleicht haben sie ja recht, wenn sie sagen: „Papa, glaubst du wirklich, dass deine Gäste dafür eine Karriere opfern würden? Die haben nie eine Karriere gemacht, deshalb sind sie hier gelandet – genau wie du!“
Aus Hanna und Kay sind zwei selbstbewusste Teenager geworden, die zumindest eines ganz sicher wissen: wie ihr Vater wollen sie niemals werden. Und das ist auch genau richtig so.